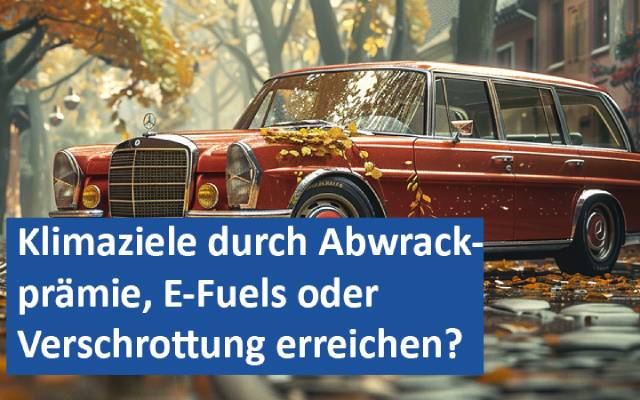Eine neue Studie des ICCT untersucht, wie eine Abwrackprämie für alte Diesel– und Benzinfahrzeuge zur Reduktion von CO₂-Emissionen beitragen könnte. Verglichen mit synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels) gilt das Abwrackmodell als kostengünstiger und effizienter. Dennoch stößt der Vorschlag auf Gegenstimmen, insbesondere von der eFuel Alliance, die auf nachhaltigere Konzepte setzt.
ICCT-Studie: Abwrackprämie als Mittel zur CO₂-Reduktion
Das International Council on Clean Transportation (ICCT) legt in seiner Studie nahe, dass ein Abwrackprogramm für ältere Verbrenner einen erheblichen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten könnte. Vorgeschlagen wird die Verschrottung von etwa acht Millionen Fahrzeugen, um bis zu elf Millionen Tonnen CO₂ einzusparen. Verglichen mit E-Fuels wären die Kosten für das Abwrackprogramm deutlich geringer: Während die CO₂-Vermeidungskosten bei E-Fuels auf rund 910 Euro pro Tonne geschätzt werden, liegt die Abwrackprämie bei nur etwa 255 bis 313 Euro pro Tonne. Mit diesen Einsparungen könnte ein Drittel der benötigten CO₂-Reduktionen im Verkehrssektor bis 2030 realisiert werden.
E-Fuels: Hohe Kosten und politische Hürden
E-Fuels, aus erneuerbaren Energiequellen gewonnene synthetische Kraftstoffe, werden in der Studie als kostspieligere Alternative beschrieben. Die Produktion in Deutschland würde rund 2,90 Euro pro Liter kosten, bei Importen etwa 2,20 Euro. Zusätzlich steht die Verfügbarkeit von E-Fuels in der Europäischen Union durch regulatorische Hürden unter Druck. Obwohl E-Fuels als wichtige Lösung für die Dekarbonisierung der Luft- und Schifffahrt anerkannt werden, ist ihr Anteil im Straßenverkehr bis 2030 in der EU nur mit einem Prozent vorgesehen.
Gesundheitsvorteile durch weniger Schadstoffe
Neben der CO₂-Reduktion sieht die ICCT-Studie in der Abwrackprämie gesundheitliche Vorteile. Besonders ältere Dieselmodelle, die hohe Schadstoffemissionen aufweisen, würden durch das Programm von den Straßen verschwinden und so die Luftqualität verbessern. Die eFuel Alliance entgegnet jedoch, dass eine solche Maßnahme wenig nachhaltig sei, da funktionstüchtige Fahrzeuge unnötig verschrottet würden. Vielmehr setzt die Interessengemeinschaft auf die Wiederverwertung bestehender Ressourcen und die Einführung eines Kreislaufsystems für Fahrzeuge und Materialien.
Kontroversen um Akzeptanz und Machbarkeit
Die eFuel-Alliance kritisiert das Abwrackprogramm als ökologisch und ökonomisch fragwürdig und verweist auf die hohen Emissionen, die bei der Produktion neuer Elektrofahrzeuge entstehen. Zudem betont die Organisation, dass die Bevölkerung dem Programm möglicherweise skeptisch gegenüberstünde, da alte Benziner oft als Sammlerstücke gelten. Laut der eFuel-Alliance wäre es vernünftiger, den Anteil von E-Fuels im Kraftstoffmarkt zu erhöhen, um auf natürliche Weise CO₂-Emissionen zu senken, anstatt nutzbare Fahrzeuge zu zerstören. Auch wirtschaftliche Aspekte sind ein Kritikpunkt: In der aktuellen Haushaltslage wäre die Finanzierung einer umfassenden Abwrackprämie fraglich.
Die Debatte um die Abwrackprämie zeigt die Spannungen zwischen kosteneffizienten Maßnahmen und der langfristigen Nachhaltigkeit. Ob die Verschrottung oder die Förderung von E-Fuels der richtige Weg ist, bleibt umstritten.
Welche Lösung halten Sie für den besten Weg zur Erreichung der Klimaziele? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren.
Basierend auf Inhalten von www.springerprofessional.de und eigener Recherche.