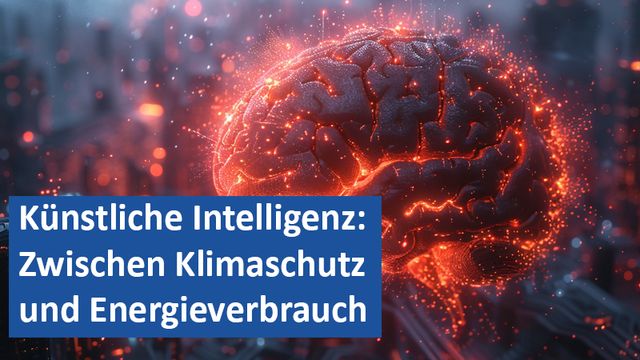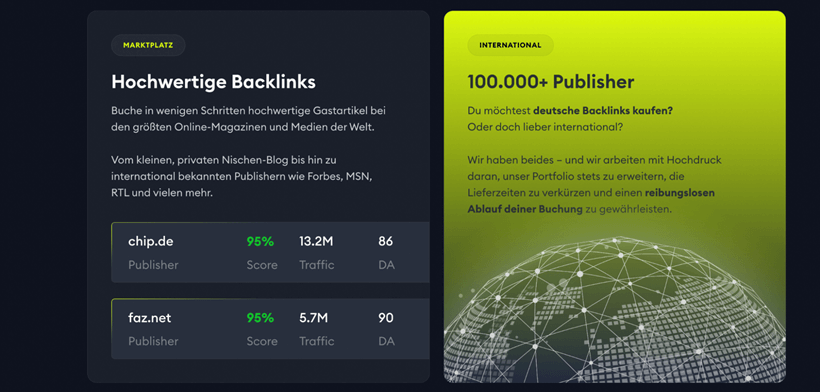Künstliche Intelligenz bringt viele Vorteile, hat aber auch einen beachtlichen Energiebedarf. Studien zeigen, dass der Stromverbrauch von KI in Europa bis 2030 erheblich steigen wird, was das Potenzial zur Belastung der Klimabilanz birgt. Ohne verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien könnte der technologische Fortschritt zum Problem für die Umwelt werden.
Der wachsende Energiehunger der KI
Eine Untersuchung von McKinsey prognostiziert, dass der Energieverbrauch von Rechenzentren für KI-Anwendungen bis 2030 mehr als 150 Terawattstunden erreichen wird. Das entspricht etwa fünf Prozent des gesamten Stromverbrauchs in Europa und ist eine deutliche Steigerung gegenüber den heutigen zwei Prozent. Die Stromversorgung dieser Rechenzentren basiert noch immer stark auf fossilen Energieträgern, obwohl führende Unternehmen wie Google, Microsoft und Amazon zunehmend auf erneuerbare Energien setzen. Dieser steigende Bedarf könnte, ohne die nötige Umstellung, die Klimabilanz erheblich verschlechtern.
Technologische Herausforderungen und Lösungsansätze
Der hohe Energieverbrauch moderner KI-Systeme ist eng mit ihrer leistungsstarken Hardware verbunden. Beispielsweise verbrauchen spezialisierte Prozessoren wie die H100 GPUs von Nvidia, die in großen Rechenzentren eingesetzt werden, pro Stück etwa 700 Watt. Solche Rechenzentren benötigen allein für das Training von Modellen bis zu 70 Megawatt, was einer Energieleistung von mehreren Windkraftanlagen entspricht. Experten wie Ralf Herbrich vom Hasso-Plattner-Institut betonen die Notwendigkeit effizienterer Algorithmen und mathematischer Verfahren, um die Energie pro Berechnungsschritt zu senken.
Erneuerbare Energien als notwendige Stütze
Um die steigende Nachfrage nach Strom für KI-Anwendungen zu bewältigen, wird der Ausbau erneuerbarer Energien dringend benötigt. Trotz aller Bemühungen ist der europäische Energiemix noch stark von fossilen Brennstoffen geprägt; im Jahr 2023 wurde etwa ein Drittel des Stroms daraus gewonnen. Um den wachsenden Bedarf zu decken und die Umweltbelastung zu minimieren, sind Investitionen in Infrastruktur und Fachkräfte ebenso notwendig wie eine verbesserte Verteilung des erzeugten Stroms. Ohne diese Schritte könnte die digitale Transformation die Klimaziele gefährden.
Die doppelte Rolle der KI im Klimakontext
Trotz ihres hohen Energieverbrauchs kann KI auch eine bedeutende Rolle im Klimaschutz spielen. Anwendungen im Energiemanagement, in der Produktionsoptimierung und im Ressourcenverbrauch zeigen das Potenzial der Technologie, Effizienz zu steigern und Emissionen zu senken. Expertinnen wie Vérane Meyer von der Heinrich-Böll-Stiftung heben hervor, dass KI beispielsweise wissenschaftliche Forschung beschleunigen und die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien vorantreiben kann. Dennoch bleibt die Herausforderung, dieses Potenzial zu realisieren, ohne die Umwelt weiter zu belasten.
Künstliche Intelligenz steht an einem Scheideweg: Sie kann zur Reduktion von Emissionen beitragen, erhöht aber gleichzeitig den globalen Energiebedarf. Nur durch den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien und effizienter Technologien kann ihr Einsatz umweltverträglich gestaltet werden. Eine kluge Kombination aus Innovation und nachhaltiger Energiepolitik ist nötig, um die Balance zu wahren.